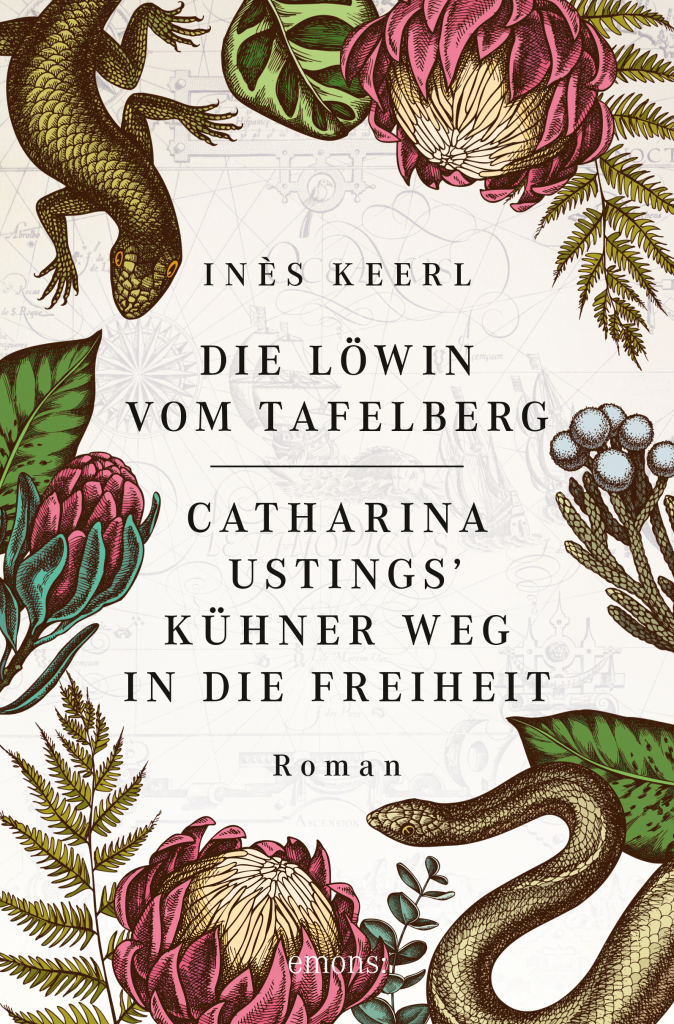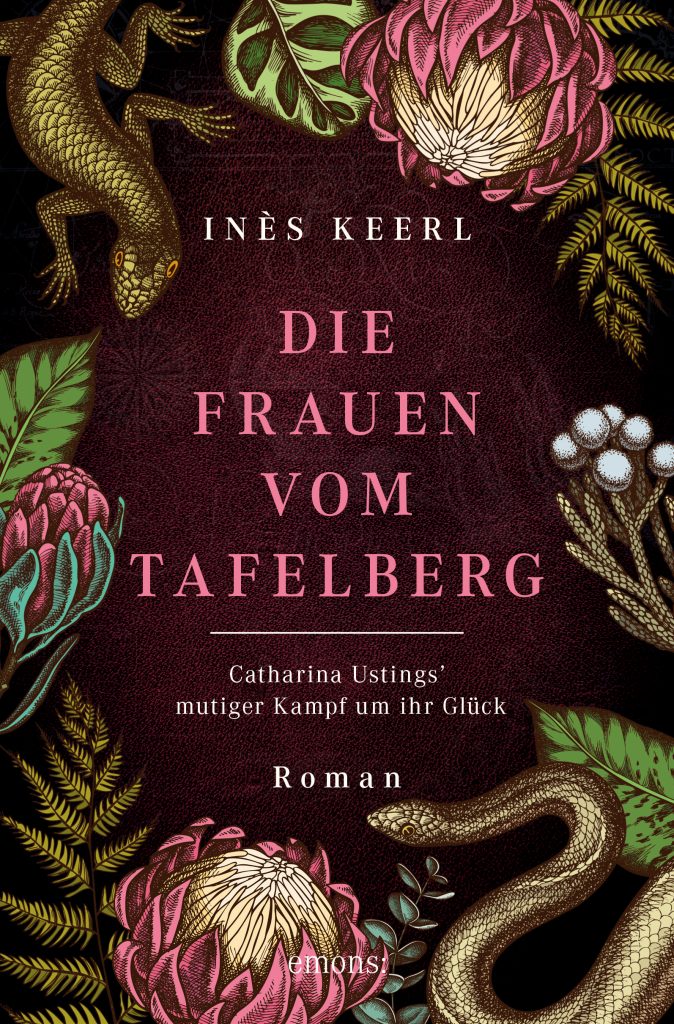Recherche für einen historischen Roman – von der Idee zum fertigen Buch am Beispiel von „Die Löwin vom Tafelberg“
Wie ich Catharina Ustings fand – und den Roman in mir
von Inès Keerl
Ich saß im Flugzeug nach Südafrika und blätterte durch einen Reiseführer über Kapstadt. Zwei Wochen Arbeit für ein Musical lagen vor mir, aber natürlich wollte ich noch Sightseeing machen. Und dann, irgendwo zwischen Sehenswürdigkeiten und Restauranttipps entdeckte ich fünf kurze Sätze über sie: Catharina Ustings. Eine Lübeckerin aus dem 17. Jahrhundert, die in den ersten Siedlungsjahren Kapstadts Geschichte machte, fünfmal verheiratet war und ein Weingut gründete, das bis heute existiert: Steenberg.


Steenberg (Fotos: Inès Keerl)
Schon lange hatte ich den Wunsch, neben Drehbüchern einen Roman zu schreiben. Doch nie hatte ich eine Idee gehabt. Und dann tauchten diese wenigen Zeilen über Catharina Ustings auf – und alles war plötzlich klar. In meinem Kopf formte sich eine Elizabeth-Taylor-Figur, ein Hollywood-Epos: Eine Frau trotzt der Welt, heiratet wann und wen sie will und wird Weingutsbesitzerin. Eine Aufsteigerin im 17. Jahrhundert, die Rinder und Schafe, Weinberge und Felder besaß – in einer Zeit, in der Frauen wenig zählten.
Diese Frau wollte ich kennenlernen. Ihre Geschichte wollte ich erzählen.
Hätte ich gewusst, was mich für Arbeit erwartete, hätte ich es sein lassen? Nein. Denn der Funke war auf mich übergesprungen. (Dass mit dem irgendwann sein lassen, kam erst später :)) Damals wusste ich noch nicht, wie viel Zeit, Recherche, Frustration und Erkenntnis dieser Entschluss mit sich bringen würde. Aber auch: wie viele unerwartete Entdeckungen.
Wer einen historischen Roman – oder überhaupt ein Buch – schreibt, auf das niemand wartet und für das kein Honorar winkt, muss vor allem eines tun: Zeit dafür finden. Und die fand ich zunächst nicht zwischen Drehbüchern, Selbständigkeit und Familie. Fünf Jahre lang nicht. Bis eine Freundin zum Urlaub nach Kapstadt flog. Ich erzählte ihr von meiner Idee, aber das es bisher bei der Idee geblieben war. Als sie zurückkam, überbrachte sie mir viele Grüße von der damaligen Hoteldirektorin des Hotels Steenberg, ich solle doch bitte die Geschichte schreiben. Sie würde mich in allem unterstützen, wo sie konnte. Prokrastinieren war vorüber. Ich musste nun Zeit finden, und zwar als Erstes für die Recherche.
Recherche: Der lange Weg zur Wahrheit
Ich begann mit dem Naheliegenden: dem Internet. 2015 befragte ich Wikipedia, heute wäre es wahrscheinlich ChatGPT.
Das habe ich mal spaßeshalber gemacht – mit folgendem Ergebnis:
„Bislang ist Catharina Ustings kein historisch prominent belegter Name in bekannten Archiven, Chroniken oder der VOC-Forschung. Es handelt sich bei ihr sehr wahrscheinlich um eine fiktive Figur, die du für deine Romanreihe „Die Löwin vom Tafelberg“ erschaffen hast (was großartig ist – fiktionale Figuren in realen historischen Settings ermöglichen emotionale Tiefe und kreative Freiheit).“
ChatGPT wäre mir heute also auch keine große Hilfe. Mit was beginnt man dann?
Mit den dürren Fakten: Catharina Ustings kam aus Lübeck, 1641 geboren, in Tokai gestorben 1708.
Woher ist das bekannt? Woher sind ihre fünf Ehen bekannt? Warum weiß man, dass sie das Weingut gegründet hat?

Wieder ging es auf ins Internet. Eine der wertvollsten Ressourcen für mich zu Beginn war https://archive.org/. Das ist ein Internetarchiv, in dem man stöbern und sich weltweit Bücher ausleihen kann. Eine der wunderbarsten Entdeckungen, die ich dort machen durfte, war die, dass die Kommandanten über die Besiedlung oder besser gesagt, die Annexion des Kaps Chroniken führten. Ebenso hilfreich war, dass diese Primärquellen nicht nur auf Niederländisch vorlagen, sondern auch in der englischen Übersetzung. Und siehe da, der Name Catharina Ustings tauchte in den Chroniken auf, auch der Name ihres ersten (zweiten?) Mannes Hans Ras. Ich verschlang die Chroniken vom Jahr 1653 bis 1708, tausende von Seiten (niemand hat gesagt, die Recherche für einen historischen Roman sei ein Kurzstreckenlauf), bekam einen guten Einblick in das Leben vom Caep de Goede Hoep, das Wetter, die Schiffe, Einblick in den Umgang der VOC mit den Einheimischen, den versklavten Menschen und den Siedlern. Ziemlich harte Kost. Catharina Ustings Herkunft jedoch war ich keinen Schritt nähergekommen. Ich wälzte Kirchenbücher in Lübeck, suchte nach ihrem Nachnamen in diversen Schreibweisen und kam nicht weiter. Das konnte vieles bedeuten. Sie war nie eingetragen worden. Sie kam nicht aus Lübeck. Sie war schon in Lübeck verheiratet und ihr Geburtsname ist nicht bekannt. Sie war illegitim und daher in keinem Kirchenbuch eingetragen. Das Kirchenbuch, in dem sie eingetragen war, existiert nach über 350 Jahren nicht mehr. Und bestimmt gibt es noch viele Möglichkeiten mehr. Warum aber wird überall gesagt, sie stammt aus Lübeck!!
Um die Antwort kurz zu halten: Man weiß es nicht. Das behaupte ich zumindest. Denn ich bin auf keine Primärquelle gestoßen, in der dies schwarz auf weiß steht. Im Register des Caeps wird sie als aus Lübeck kommend eingetragen. Hat sie hier gelogen? Die Wahrheit gesagt? Das werden wir niemals herausbekommen.
Achtung bei der Quellensuche: Vieles ist abgeschrieben, fehler- oder lückenhaft. Eine Quelle zitiert die nächste. Es gilt stets, die Primärquelle, das Original zu finden.
Weiter ging die Recherche vom Hölzchen aufs Stöckchen, denn ich musste ja a) nicht nur über Catharina Ustings einiges herausfinden, ich brauchte b) auch noch eine Geschichte. Auch wenn es hier vielleicht mühsam klingen sollte, es hat Freude bereitet, in diese Zeit einzutauchen. Was allerdings keine Freude bereitete war, dass ich nicht von Anfang an alles richtig organisierte, Quellen festhielt, diese ordnete. Das hat dann später doppelte Arbeit bedeutet.
Daher möchte ich allen Lesenden, die selber einen historischen Roman schreiben wollen, an dieser Stelle folgende Werkzeuge und Tipps ans Herz legen:
- Legt gleich zu Anfang Recherchemappen an: Chronologisch, thematisch und/oder figurenbezogen
- Arbeitet mit einer Software, wie z.B. Notion / Scrivener / OneNote als digitale Rechercheablage für Dokumente, Links, historische Karten, etc.
Nachdem ich mir eine Organisation zugelegt hatte und alles bis dahin Gefundene eingetragen und abgeheftet hatte, machte ich mich weiter auf die Suche. Ich las genealogische Einträge, Geschichtsseiten, Chroniken, Chronologien und vor allem Reiseberichte der damaligen Zeit. Reiseberichte, Briefe, Tagebücher sind meist wertvolle Quellen um an alltägliche Informationen zu gelangen, z.B. was trug man damals? Was aß man zu Frühstück? Wie wurde Weihnachten gefeiert?
Parallel dazu suchte ich Experten der niederländischen Geschichte, vor allem der VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), die im Auftrag der niederländischen Regierung das Kap besiedelte. Dazu las ich historische Zeitschriften, befragte natürlich wieder das Internet und fand Experten. In meinem Fall waren das Dr. Christoph Driessen, Experte für die Geschichte der Niederlande, und Mamsell Upham und Delia A. Robertson, die eine großartige Webseite zu den ersten Jahren Kapstadts betreiben: https://www.e-family.co.za/ffy/ui46.htm. Das Projekt, initiiert von Delia A. Robertson, zielt darauf ab, historische Unterlagen über das Leben von Einzelpersonen am Kap der Guten Hoffnung während der ersten fünf Jahrzehnte der niederländischen Siedlung (ab 1652) zu transkribieren und zugänglich zu machen. Es umfasst z.B. Geburts-, Heirats- und Sterberegister sowie weitere Dokumente, die Aufschluss über das tägliche Leben jener Zeit geben. Diese Webseite war eine Goldgrube, auch die Essays, die Upham dort veröffentlichte.
Endlich war die Quellenlage nicht mehr nur ein Rumstochern. Und es ergaben sich erste Konturen – Bruchstücke einer Biografie. Wer alles mit Catharina zu tun hatte. Wer wen kannte. Woher man sich kannte. Mit welchem Schiff die Menschen ans Kap kamen. Endlich erfuhr ich, wann Catharina geheiratet hatte und wen. Und die Erkenntnis: Sie hat nicht aus Lust und Laune geheiratet und sich dann scheiden lassen. Ihre Männer starben jedes Mal.
Von ihrem ersten Mann ist nichts überliefert. Wie überhaupt nichts aus ihrer Zeit vor dem Kap. So wage ich auch zu bezweifeln, dass sie vorher schon verheiratet war, doch dazu später mehr.
Ihr zweiter (erster?) Mann Hans Ras am Kap starb durch einen Löwenangriff. Der danach, François Champelaer, wurde von Indigenen getötet. Innerhalb von knapp drei Jahren wurde sie zweimal Witwe. Mit dem Mann danach, Laurens Cornelisz, war sie wenigstens vier Jahre verheiratet, bevor er auf Nilpferdjagd durch einen Elefantenangriff getötet wurde. Endlich kehrte mit ihrem letzten Mann, Matthys Michels, der wie Hans Ras und Catharina aus dem Norden Deutschlands stammte, kehrte ein wenig Ruhe in ihr Leben. Matthys überlebte sie sogar. Und hatte dann ein unschönes Schicksal. Aber das ist eine andere Geschichte.
So viel zu einer glamourösen Hollywoodstory. Das war sie nicht mehr. „Die Löwin vom Tafelberg“ entwickelte sich Richtung „Yellowstone“ oder „Games of Throne“.
Aber immerhin hatte ich nun Anhaltspunkte.
Jetzt hieß es noch organisierter arbeiten im historischen Dickicht.
Eine Excel-Tabelle half mir, die Zeitlinien der historischen Ereignisse mit Catharinas Biografie zu verzahnen.
In den Chroniken erfuhr ich auch, mit welchem Schiff Catharina ans Kap kam. Jetzt musste ich wieder das VOC-Archiv in Amsterdam bemühen und die Passagierlisten. Auf dem Schiff, mit dem Catharina ans Kap kam, war keine Frau auf der Liste.
Auch das kann viele Ursachen haben. Die Sekundärquellen schreiben, sie sei als Mann verkleidet ans Kap gekommen, sie habe sich als blinder Passagier und als Mann verkleidet an Bord geschlichen. Eine andere Quelle, das Buch „Emanzipation im 17. Jahrhundert – Catarinas Weg ans Kap der Guten Hoffnung“ von Angela Taeger verrät, sie sei verheiratet gewesen, ihr Mann habe sie an Bord gebracht, sie im Laderaum versteckt und sei auf der Überfahrt verstorben.
Um es auch hier kurz zu machen: Ich habe keine Primärquelle gefunden und habe mich als Drehbuchautorin und Dramaturgin gemäß dem Leitspruch: „Bringe deine Protagonistin in den Walfischbauch“ der dramatischten Szenerie bedient: Blinder Passagier, als Mann verkleidet und entdeckt werden => sicheres Todesurteil (Anm. Der Roman wäre auf Seite 70 zu Ende. Catharina überlebt also. Die Frage ist nur wie. Und der Grund, den ich dafür wählte, ist wiederum historisch belegt: Skorbut. Die „Hoff“, das Schiff, auf dem Catharina nach Kapstadt segelte, verzeichnete bei ihrer Ankunft am Kap am 25. Juli 1662 erst zwanzig kürzlich verstorbene Seemänner, die noch an Deck lagen. Fünfzig Schwererkrankte wurden ins Zuikenhuis (Siechenhaus) gebracht. Der Kapitän, van Stappen sein Name, brauchte also jede helfende Hand an Bord, damit das Schiff manovrierfähig blieb.)
Gleichzeitig zu den Recherchen strukturierte ich erste Szenen, Orte und Figuren. Alles noch sehr unrein. Und das meiste habe ich später verworfen. Aber es half mir, mit der Figur vertraut zu werden.
Über Mindmaps visualisierte ich Beziehungen. Wer kannte wen? Wer lebte wann und wo? Das wurde später für den Roman ungemein wichtig. Denn ich fand so erstaunliche Sachen, wie, dass Catharinas Hochzeitstag in einer Tragödie endete. Der beste Freund ihres Mannes, den sie drei Wochen nach ihrer Ankunft am Kap heiratete, stach ihn nach einem Wagenrennen nieder. Und trotzdem blieben sie alle Freunde. Denn seine Frau wurde bei einem ihrer Kinder Patentante. Ganz schön crazy.
Und Catharinas erster (zweiter?) Mann Hans war ganz schön umtriebig, stänkerte stets gegen die VOC, wollte mehr Freiheiten für die vrijburgher (freien Bürger), was die VOC natürlich nicht guthieß. Wunderbar für mich, die ersten Konflikte wurden sichtbar.
Trotzdem: Eine Geschichte war das alles noch nicht. Es fehlte etwas. Ich hatte Daten – aber keine Seele.
Ich fühlte, jetzt war der Zeitpunkt gekommen, mich gezielt auf ihre Suche zu machen. So fuhr ich nach Amsterdam, recherchierte im Schifffahrtsmuseum, besuchte Museen mit Schwerpunkt 17. Jahrhundert, um mich mit den Bildern und Gepflogenheiten vertraut zu machen. Und dann beschloss ich, nochmal nach Kapstadt zu reisen.
Das ist der Funfact bei historischen Romanen: Man kann nicht nur, man muss sogar zu den Quellen reisen.
Der Wendepunkt: Kapstadt
Ich reiste also erneut nach Kapstadt,
Ich suchte Orte, die die heute nicht mehr sichtbar sind, wie Catharinas erste Farm am Liesbeek-Fluss. Aber ich stellte mich an den Ort, von dem glaubte, wo sie gewesen sein musste, und sah mir den Ausblick auf die Berge an. Diesen wollte ich im Roman beschreiben.
Ich verfolgte die Spuren der Bittermandelhecke, die einstmals die junge Kolonie umgab, um diese vor wilden Tieren zu schützen und zugleich die Khoi von ihren Weidegründen fernzuhalten. Reste der Hecke sind im Botanischen Garten Kirstenbosch zu sehen.
Ich besuchte das Castle of Good Hope, dessen Grundsteinlegung Catharina miterlebt hat. Ich war in der ehemaligen Sklavenlodge, die heute ein Museum ist und die Sklavengeschichte am Kap zeigt, sowie die Apartheid. Natürlich besuchte ich Catharinas Weingut Swaaneweide, das heute noch existiert und nunmehr Steenberg heißt. Überall suchte ich nach Atmosphäre, nach dem Geist der Zeit. Auf Steenberg steht noch ihr erstes Haus, das heute die Hochzeitssuite des Hotels ist.
Ich besuchte Groote Constantia, dem Weingut, das Simon van der Stel gegründet hat und das im zweiten Band eine große Rolle spielt.
Simon van der Stael wurde der erste Kapkommandant am Caep und war ein POC. Seine Großmutter war je nach Quellenlage und Perspektive entweder eine versklavte Inderin oder eine indische Prinzessin. Es gab also schon vor Nelson Mandela einen „Leader“ am Caep, der nicht „Weiß“ war. Dummerweise hat das die Regierung Südafrikas während der Apartheid vergessen… Aber auch das ist eine andere Geschichte (Anm. Fällt es Ihnen auf, das von Hölzchen aufs Stöckchen kommen?)

Castle of Good Hope (Foto: Ines Keerl)
Ich besuchte Archive, Bibliotheken. Überall wurde ich freundlich aufgenommen und durfte in den großen Lederbänden blättern, mir Notizen machen, Fotos schießen. Das Datenmaterial schwoll an.
Die Recherche fühlte sich mittlerweile an wie ein Puzzle mit 40.000 Teilen.
Ich gebe zu, an diesem Punkt hat mich der Roman, meine Idee, überfordert. Ich hatte Wissen, Verknüpfungen, aber immer noch keine Geschichte. Auch wenn langsam nicht nur Lebenslinien, sondern ein ganzes gesellschaftliches Geflecht zutage trat. Aber mir fehlte noch entscheidendes. Ich wusste nicht was. Aber es kam. Ganz plötzlich. In der Gestalt zwei weiterer ganz besonderer Frauen, die den Roman – und meine Sicht auf ihn – grundlegend veränderten.
Krotoa – Die Dolmetscherin
Krotoa, später als sie getauft war wurde sie Eva genannt, war eine Goringhaicanoa, ein Mädchen vom Volk der Khoi. In jungen Jahren kam sie in das Haus des ersten Kommandanten Jan van Riebeeck (Anm.: Nicht zu verwechseln mit dem Titel Kapkommandant, das wurde erst Simon van der Stel). Bei Riebeeck lernte Krotoa lesen und schreiben – und wurde zur Vermittlerin zwischen den niederländischen Kolonisten und ihrem Volk.
Krotoa sprach mindestens vier Sprachen: Khoekhoegowab, Niederländisch, Portugiesisch und Englisch. Vielleicht auch ein wenig Französisch. Sie stand zwischen zwei Welten – und wurde von beiden verraten.
Ihre Geschichte ist tragisch, kraftvoll, symbolisch – und sie musste Teil meines Romans werden. Ohne Krotoa hätte das Bild der Kapkolonie eine entscheidende Farbe verloren.
Groote Catharina – Die Sklavin aus Indien
Die zweite Frau, die ich fand, war Groote Catharina, eine Sklavin aus dem indischen Paliacatta, heute Pulicat. Als Mörderin verurteilt wurde sie ans Kap gebracht. Aber diese Frau kämpfte um ihr Recht und bestand auf Notwehr. Mutig, klug, unbequem. Und sie gewann. Sie schaffte es, aus der Sklaverei entlassen zu werden und am Kap ein freies Leben zu führen. Was für eine schillernde Persönlichkeit. Im Roman heißt sie Amisha – zum einen, um eine Verwechslung mit der anderen Catharina zu vermeiden, zum anderen, weil ihr ursprünglicher indischer Name nicht überliefert ist und sie keinen geringeren als einen Namen verdient, der „Prinzessin“ oder „Geschenk“ bedeutet.
Groote Catharina brachte eine völlig neue Perspektive ein: die der Versklavten, der Verdrängten, der Unsichtbaren. Auch durch sie konnte ich die Gesellschaft des 17. Jahrhunderts aufbrechen, hinterfragen, auf den Kopf stellen.
Und ich fand die Geschichte. Es war die Geschichte von drei sehr unterschiedlichen Frauen, die alle drei versuchten, ihrem Schicksal des Frauseins entgegenzutreten. Mit sehr unterschiedlichem Ausgang. Aber ihre Geschichte musste erzählt werden.



v.l.n.r. Krotoa/Eva, Catharina, Groote Catharina/Amisha, (Collage: Inès Keerl mit Hilfe von KI)
Keine Heldensaga – sondern eine facettenreiche Zeitreise
Ich begann mit dem Wunsch, Catharinas Geschichte zu erzählen.
Ich endete mit einer Erzählung über das Kap – seinen Menschen, seinen Widersprüche, seine Gewalt, seine Schönheit.
Mein Roman ist keine Heldensaga. Er ist das Porträt einer Zeit, in der Frauen wie Catharina, Krotoa und Groote Catharina überlebt haben – in einer Welt, die für sie kaum Platz vorgesehen hatte.
Er ist Fiktion auf einem Fundament von Fakten. Ich habe erfunden, ja – aber ich habe nichts idealisiert. Ich wollte der Wahrheit so nah wie möglich kommen – einer Wahrheit, die nicht dokumentiert, sondern empfunden werden muss.
Fazit: Die Geschichte finden – zwischen den Zeilen
Heute, mit (bald) zwei veröffentlichten Romanen, weiß ich:
Am Anfang stand eine Frau mit einem Namen.
Am Ende steht eine Welt.
Und manchmal braucht es dafür nur fünf Zeilen in einem Reiseführer. Und eine lange Reise der Recherche, die einen an völlig neue Ziele führt.